ADHS tritt selten allein auf. Viele Betroffene leiden nicht nur unter den typischen Symptomen wie Konzentrationsschwierigkeiten, Impulsivität und innerer Unruhe, sondern auch unter weiteren psychischen oder somatischen Erkrankungen. Diese sogenannten Komorbiditäten sind nicht nur häufig, sondern auch diagnostisch und therapeutisch besonders relevant. In diesem Artikel zeigen wir dir, welche Begleiterkrankungen bei ADHS am häufigsten auftreten, wie sie sich bemerkbar machen, warum sie oft übersehen werden und welche Behandlungsmöglichkeiten bestehen (Sobanski et al., 2017).
Was bedeutet Komorbidität bei ADHS?
Der Begriff Komorbidität beschreibt das gleichzeitige Auftreten von zwei oder mehreren Erkrankungen bei einer Person. Bei ADHS ist dies besonders häufig: Studien zeigen, dass bis zu 80 % der Erwachsenen mit ADHS mindestens eine weitere psychische Störung aufweisen. Bei Kindern liegt die Quote bei etwa 50 bis 70 % (Grogan et al., 2022).
Komorbiditäten von ADHS sind nicht zwangsläufig Folgeerscheinungen, sondern können parallel entstehen, zum Beispiel aufgrund gemeinsamer genetischer, neurobiologischer oder psychosozialer Risikofaktoren. In anderen Fällen entstehen sie sekundär, also als Folge unbehandelter oder schlecht verstandener ADHS-Symptome oder negativer Erfahrungen im sozialen Umfeld (Grogan et al., 2022).
Diese Komorbiditäten können die Lebensqualität stark beeinträchtigen und die Diagnostik sowie Therapie deutlich erschweren. Deshalb ist es wichtig, die Symptome im Zusammenhang zu betrachten und eine fundierte Differenzialdiagnose zu stellen (Grogan et al., 2022).
Häufige Komorbiditäten bei ADHS
Hier ein erweiterter Überblick über die häufigsten Begleiterkrankungen bei ADHS:
- Depressionen
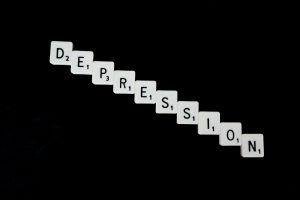
Viele ADHS-Betroffene entwickeln im Laufe ihres Lebens depressive Episoden. Studien zeigen, dass Menschen mit ADHS ein 5-fach erhöhtes Risiko für Depressionen haben. Ursachen sind oft chronisches Scheitern im Alltag, geringes Selbstwertgefühl oder soziale Isolation. Die Symptome überlappen sich teilweise mit ADHS (z. B. Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörungen), was die Diagnose erschwert (Adler et al., 2009).
- Angststörungen
Ob generalisierte Angst, Panikattacken oder soziale Phobie: Etwa 50 % der Erwachsenen mit ADHS leiden gleichzeitig an einer Angststörung. Besonders bei Frauen ist diese Kombination häufig. Die Angst kann sich aus negativen Lernerfahrungen entwickeln oder durch die ständige Reizüberflutung verstärkt werden (Adler et al., 2009).
- Suchterkrankungen
Abhängigkeiten von Alkohol, Nikotin, Cannabis oder anderen Substanzen treten bei ADHS-Betroffenen deutlich häufiger auf. Auch Verhaltenssüchte wie exzessives Gamen, Internetsucht oder Essanfälle können auftreten. Rund 15 % der Erwachsenen mit ADHS haben eine Suchterkrankung. Suchterkrankungen sind oft ein Versuch, mit der inneren Unruhe oder Überforderung umzugehen (Adler et al., 2009).
- Schlafstörungen
Ein- und Durchschlafprobleme sind unter Menschen mit ADHS besonders verbreitet. Die Symptome der Schlaflosigkeit verstärken wiederum die ADHS-Symptomatik, ein klassischer Teufelskreis. Auch ein unregelmässiger Schlafrhythmus oder nächtliches Grübeln sind häufig (Adler et al., 2009).
- Essstörungen
Binge-Eating, Bulimie oder auch atypisches Essverhalten treten bei ADHS-Betroffenen häufiger auf. Impulsivität, mangelnde Selbstregulation und emotionales Essverhalten gelten als Risikofaktoren. Essstörungen treten oft gemeinsam mit niedrigem Selbstwertgefühl und Selbstregulationsproblemen auf (Fassbender et al., 2024).
- Bipolare Störung
Zwar schwieriger zu diagnostizieren, aber nicht selten: Bei etwa 10 % der Erwachsenen mit ADHS tritt eine bipolare Störung auf. Die Symptome überlappen sich teilweise, etwa in Form von Stimmungsschwankungen, erhöhter Aktivität und Impulsivität. Es ist essenziell, beide Störungen differenziert zu behandeln (Fassbender et al., 2024).
- Borderline-Persönlichkeitsstörung
ADHS und Borderline weisen eine ähnliche Impulsivität auf, dennoch handelt es sich um zwei unterschiedliche Störungsbilder. Beide können gemeinsam auftreten. Die emotionale Instabilität bei Borderline ist stärker ausgeprägt, was bei der Diagnosestellung beachtet werden muss (Fassbender et al., 2024).
- Autismus-Spektrum-Störung
Die Kombination aus ADHS und Autismus war früher undenkbar, gilt heute aber als möglich und gar nicht so selten. Etwa 30-50 % der Kinder mit Autismus zeigen auch ADHS-Merkmale. Beide Störungen können sich in sozialem Rückzug, Kommunikationsproblemen und speziellen Interessen überschneiden (Park et al., 2022).
- Lernstörungen
Zu den typischen komorbiden Störungen bei ADHS-Kindern zählen Legasthenie (Lese-Rechtschreib-Schwäche) und Dyskalkulie (Rechenschwäche). Die Kombination aus ADHS und LRS ist besonders häufig und beeinträchtigt schulische Leistungen erheblich (Park et al., 2022).
- Tic-Störungen und Tourette-Syndrom
Auch Tic-Störungen treten vermehrt in Kombination mit ADHS auf. Es handelt sich hierbei meist um motorische oder vokale Tics, die vor allem im Kindesalter beginnen. Die Kombination kann die Lebensqualität zusätzlich einschränken (Park et al., 2022).
Weitere mögliche Komorbiditäten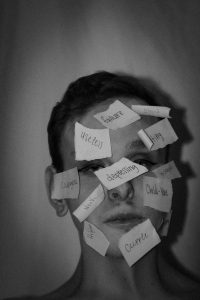
Neben den oben genannten treten auch folgende Störungen vermehrt gemeinsam mit ADHS auf:
- Zwangsstörungen
- Störung des Sozialverhaltens
- Oppositional Defiant Disorder (ODD)
- Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS)
- Persönlichkeitsstörungen allgemein
Komorbiditäten erkennen: Warum die richtige Diagnose so wichtig ist
Eine reine ADHS ohne weitere Störungen ist die Ausnahme. Das erschwert die Diagnostik erheblich. Gerade im Erwachsenenalter steht oft die Depression, Angst oder Sucht im Vordergrund, sodass die eigentliche ADHS lange unentdeckt bleibt (Park et al., 2022).
Die Abgrenzung ist jedoch wichtig, da sich Symptome überlappen können:
- Konzentrationsprobleme bei ADHS vs. bei Depression
- Impulsivität bei ADHS vs. bei Borderline
- Antriebslosigkeit durch Depression vs. durch Erschöpfung bei ADHS
- Angstbedingte Unruhe vs. motorische Unruhe
- Starke Reizoffenheit bei Hochsensibilität vs. ADHS-Reizfilterschwäche
Ohne eine genaue Diagnostik besteht die Gefahr von Fehldiagnosen und ineffektiven Behandlungsstrategien. Eine integrative Betrachtung durch erfahrene Fachpersonen ist daher essenziell (Park et al., 2022).
Behandlung bei ADHS mit Komorbiditäten
Die Therapie muss sich an der individuellen Konstellation orientieren. Grundsätzlich gilt:
- ADHS sollte nicht unbehandelt bleiben, selbst wenn die Komorbidität vordergründig erscheint.
- Eine multimodale Behandlung ist besonders effektiv: Kombination aus Psychotherapie, ggf. Medikation, Alltagsstruktur, Psychoedukation und bei Bedarf Coaching.
- Begleiterkrankungen wie Depression oder Angststörungen müssen parallel behandelt werden.
Die Behandlung erfolgt in der Schweiz meist durch psychiatrisch oder psychologisch geschultes Fachpersonal. Besonders wichtig ist eine gute Abstimmung aller Beteiligten, ggf. auch interdisziplinär mit Hausärzten, Schlafmedizin oder Suchtberatung (Faraone et al., 2025).
Fazit: ADHS ist selten allein, aber gut behandelbar
ADHS bringt oft «unsichtbare Begleiter» mit sich, von Depressionen und Ängsten bis hin zu Lernstörungen oder Suchterkrankungen. Wer die Symptome richtig erkennt und behandelt, kann trotz mehrfacher Herausforderungen ein erfülltes Leben führen.
Eine sorgfältige Diagnose, ein strukturierter Therapieplan und viel Verständnis für sich selbst bilden die Basis für mehr Lebensqualität.
Hinweis: Du vermutest ADHS und möglicherweise eine oder mehrere Begleiterkrankungen? Wir unterstützen dich mit einer fundierten Abklärung, online, unkompliziert und individuell. Jetzt kostenlos Kontakt aufnehmen!




