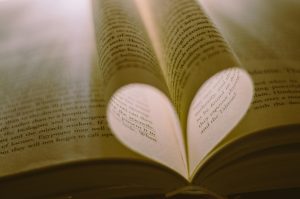Obwohl ADHS mittlerweile weit verbreitet ist und viele Menschen, Kinder wie Erwachsene, davon betroffen sind, kursieren noch immer zahlreiche Mythen und Missverständnisse. Diese falschen Annahmen erschweren nicht nur die Diagnosestellung, sondern verhindern auch, dass Betroffene die Hilfe erhalten, die sie brauchen. In diesem Artikel klären wir über die 7 häufigsten ADHS-Mythen auf, zeigen, was wissenschaftlich wirklich belegt ist, und geben dir fundierte Hintergrundinformationen zur Einordnung (Cortese et al., 2012).
Mythos 1: ADHS ist nur eine «Modekrankheit»
Noch immer glauben viele, ADHS sei ein Trendphänomen, das heutzutage überdiagnostiziert werde. Dabei ist ADHS als neurobiologische Störung seit Jahrzehnten bekannt und gut erforscht. Der Anstieg der Diagnosen erklärt sich durch ein grösseres Bewusstsein in Gesellschaft und Medizin, verbesserte Diagnosetools und eine Enttabuisierung psychischer Erkrankungen (Cortese et al., 2012).
Tatsächlich gibt es Hinweise, dass ADHS in der Vergangenheit oft nicht erkannt wurde, vor allem bei Mädchen, Frauen und Erwachsenen. Die Vorstellung, dass ADHS nur ein modischer Begriff für «lebendige Kinder» sei, ist wissenschaftlich nicht haltbar (Cortese et al., 2012).
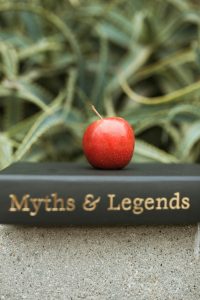
Mythos 2: ADHS gibt es nur bei Kindern
Tatsächlich war ADHS lange Zeit als reine Kinderkrankheit bekannt. Heute weiss man jedoch, dass ADHS bei vielen Menschen bis ins Erwachsenenalter bestehen bleibt. Die Symptome ändern sich mit dem Alter: Aus motorischer Unruhe wird innere Anspannung, aus impulsivem Verhalten werden emotionale Reizbarkeit oder Entscheidungsprobleme. Konzentrationsschwierigkeiten und Organisationsthemen bleiben oft bestehen (Faraone et al., 2015).
Studien zeigen, dass bis zu zwei Drittel der Kinder mit ADHS auch als Erwachsene noch Symptome aufweisen. Trotzdem bleibt die Diagnose bei Erwachsenen häufig aus, was nicht zuletzt am Mythos liegt, ADHS würde sich «auswachsen» (Faraone et al., 2015).
Mythos 3: Wer sich konzentrieren kann, hat kein ADHS
Viele glauben, dass ADHS eine generelle Unfähigkeit zur Konzentration bedeutet. Das stimmt nicht. Menschen mit ADHS können sich sehr wohl konzentrieren – oft sogar besonders intensiv. Man spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten Hyperfokus: ein Zustand intensiver Konzentration auf ein Thema, das gerade besonders interessant oder stimulierend ist. In dieser Phase blenden Betroffene alles andere aus (Banerjee et al., 2023).
Das Problem liegt nicht in der grundsätzlichen Konzentrationsfähigkeit, sondern in der Steuerung der Aufmerksamkeit. Betroffene haben Mühe, ihre Konzentration bewusst und flexibel zu lenken, besonders bei langweiligen, repetitiven oder wenig belohnenden Aufgaben (Banerjee et al., 2023).
Mythos 4: ADHS ist eine Erziehungsfrage
Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass ADHS durch falsche Erziehung entstehe. Zwar beeinflussen Erziehungsstil und Umweltfaktoren den Verlauf der Störung, sie sind aber nicht die Ursache. ADHS ist eine neurobiologische Entwicklungsstörung mit genetischer Grundlage (Demontis et al., 2023).
Die Forschung zeigt: Der Erziehungsstil kann Symptome verstärken oder abmildern, aber nicht auslösen. Besonders belastend ist für Eltern, dass sie häufig die Schuldzuweisung erfahren, obwohl sie sich für ihre Kinder engagieren (Demontis et al., 2023).
Stattdessen brauchen Familien professionelle Unterstützung, damit sie angemessen auf die Bedürfnisse ihrer Kinder reagieren können (Demontis et al., 2023).
Mythos 5: ADHS-Medikamente machen abhängig
Viele Menschen haben Angst vor Medikamenten wie Methylphenidat (z. B. Ritalin) oder Amphetamin-Derivaten. Diese Sorge ist nachvollziehbar, aber unbegründet, wenn die Medikamente richtig eingesetzt werden (Faraone & Larsson, 2019).
Fachpersonen verschreiben ADHS-Medikamente in der Regel nur nach sorgfältiger Abklärung. Studien zeigen, dass diese Medikamente nicht nur nicht abhängig machen, sondern in vielen Fällen sogar das Risiko für Suchterkrankungen senken können. Denn unbehandeltes ADHS geht mit einer erhöhten Suchtgefahr einher (Faraone & Larsson, 2019).
Medikamente sind jedoch kein Allheilmittel. Sie sollten immer Teil eines multimodalen Therapiekonzepts sein, das auch Psychoedukation, Coaching und Psychotherapie umfasst (Faraone & Larsson, 2019).
Mythos 6: ADHS betrifft hauptsächlich Jungs
Statistisch wird ADHS bei Jungen häufiger diagnostiziert. Doch das bedeutet nicht, dass Jungen auch häufiger betroffen sind. Vielmehr unterscheiden sich die Symptome: Jungen zeigen öfter die hyperaktive, impulsive Form, die im Schulalltag auffällt. Mädchen neigen hingegen zur unaufmerksamen Variante mit starker emotionaler Sensibilität.
In der Folge bleiben viele Mädchen und Frauen unerkannt, und erhalten erst im Erwachsenenalter eine Diagnose. Besonders in der Schweiz ist geschlechtssensible Diagnostik noch nicht flächendeckend umgesetzt, was dazu führt, dass ADHS bei Frauen deutlich unterdiagnostiziert bleibt (Faraone & Larsson, 2019).
Mythos 7: ADHS ist eine Ausrede für Faulheit
Dieser Mythos ist besonders verletzend für Betroffene. Menschen mit ADHS müssen oft enorme Energie aufbringen, um alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Ihr Verhalten ist keine Willensschwäche, sondern Folge einer veränderten Hirnchemie (Castellanos & Tannock, 2002).
Typisch sind Schwierigkeiten mit Zeitmanagement, Priorisierung und Umsetzung von Aufgaben. Das führt oft dazu, dass ADHS-Betroffene als «faul» oder «unzuverlässig» wahrgenommen werden. Tatsächlich ist es aber häufig das Gegenteil: Viele sind hoch motiviert, kreativ, leidenschaftlich, aber scheitern an Struktur und Selbstregulation (Wang et al., 2024).
Fazit: Aufklärung hilft allen
Falsche Vorstellungen über ADHS halten sich hartnäckig. Sie erschweren Diagnostik, Therapie und das Selbstbild der Betroffenen. Wer die Störung besser versteht, kann Menschen mit ADHS gezielter unterstützen, Stigmatisierung abbauen und einen wichtigen Beitrag zur Enttabuisierung leisten.
Wenn du dich in einigen Punkten wiedererkennst oder vermutest, betroffen zu sein, helfen wir dir gerne weiter, mit einer individuellen Online-Abklärung und Therapieoptionen, die zu dir passen. Sprich uns an!